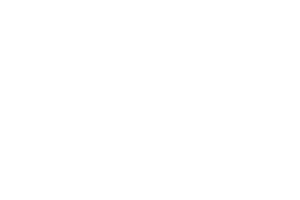Am 3. Februar 2017 ist das „Gesetz zur Änderung der Vorschriften zur Vergabe von Wegenutzungsrechten zur leitungsgebundenen Energieversorgung“ in Kraft getreten. Hinter diesem sperrigen Titel verbergen sich neue rechtliche Rahmenbedingungen, die die Konzessionsvergabe für den Strom- und Gasnetzbetrieb präziser regeln. Für Kommunen und Energieversorgungsunternehmen ist das von erheblicher Bedeutung: In der Vergangenheit landeten viele Auswahlverfahren zur Klärung, wer in einer Gemeinde das Recht bekommt, das örtliche Versorgungsnetz zu betreiben, vor deutschen Gerichten. „Die Neuregelung soll künftig die Rechtssicherheit erhöhen“, sagt Sebastian Helmes von der Beratungsgesellschaft Sterr-Kölln & Partner. „Allem voran wird nun erstmals gesetzlich die umstrittene Frage geklärt, welcher Netzpreis angemessen ist. Auch das Verfahren zur Ausschreibung der Wegenutzungsrechte ist jetzt ausdrücklich geregelt.“ So manche Frage bleibt jedoch weiterhin unklar.
Nur wer mit einer Kommune einen entsprechenden Vertrag über die Nutzung der Straßen und Wege abgeschlossen hat, darf ein örtliches Strom- oder Gasnetz betreiben. Der geeignetste Bewerber wird in einem diskriminierungsfreien und transparenten Auswahlverfahren ermittelt. Die im Allgemeinen schlicht als „Konzessionsverträge“ bezeichneten Vereinbarungen dürfen nach § 46 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eine Laufzeit von 20 Jahren nicht übersteigen. So soll der Wettbewerb in diesem Sektor sichergestellt werden.
In ihrer Bedeutung sind diese Vereinbarungen nicht zu unterschätzen. Die damit erlösten Konzessionsabgaben stellen für die Kommunen eine signifikante Einnahmequelle dar. Aus Sicht der Netzbetreiber sind diese Verträge nicht weniger wichtig; schließlich verleihen sie ein exklusives Recht zum – meist lukrativen – Netzbetrieb vor Ort. Da verwundert es nicht, dass sich meist mehr als nur ein Unternehmen um die Konzession bewirbt. Weil zudem in vielen Kommunen der politische Wille herrscht, die Netze wieder in die eigenen Hände zu nehmen, Stichwort Rekommunalisierung, sind Konflikte vorprogrammiert.
Recht schaffte bisher keine Sicherheit – das soll anders werden
Nicht einfacher machte es bislang die Rechtslage, die im Vergleich zu anderen Fragen des Energiewirtschaftsrechts nur recht rudimentär ausgestaltet gewesen ist. Die Folge: erhebliche Rechtunsicherheit bei den Beteiligten und eine Vielzahl gerichtlicher Auseinandersetzungen in den letzten Jahren. Bis zum Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht prozessierten manche Beteiligte. An dieser Stelle setzt die Gesetzesnovelle an – mit dem Ziel, die Rechtssicherheit zu erhöhen. „Mit ihr will der Gesetzgeber einige der wesentlichen Streitpunkte der letzten Jahre klären“, erklärt Sebastian Helmes. „Allem voran wird nun erstmals gesetzlich die umstrittene Frage geklärt, welcher Netzkaufpreis angemessen ist. Dies soll nach dem Willen des Gesetzgebers der objektivierte Ertragswert sein, wenn nichts anderes vereinbart worden ist.“
Den Schwerpunkt der Neuregelung bilden aber Verfahrensvorschriften, denen – angesichts des Diskriminierungsverbots und der vielen Beteiligten – eine ebenfalls nicht zu unterschätzende Bedeutung zukommt. „So ist das Verfahren zur Ausschreibung der Wegenutzungsrechte erstmals ausdrücklich gesetzlich geregelt“, so der Rechtsexperte von Sterr-Kölln & Partner. „Es orientiert sich ersichtlich an dem Vergaberecht.“ Neu sind auch Regelungen zur Bekanntmachung, zur Interessenbekundungsfrist, zur Mitteilung der Auswahlkriterien sowie zur Vorabinformation unterlegener Bieter (§ 46 III bis V EnWG). Ein Auskunftsanspruch der Gemeinde gegen den bisherigen Netzbetreiber ist nun ebenfalls ausdrücklich vorgesehen (§ 46a EnWG) Hinzu kommen Regelungen zu Rügeobliegenheiten unterlegener Bieter und zur Präklusion im Falle ihres Unterlassens (§ 47 EnWG).
In letzter Sekunde sind außerdem noch Regelungen dazu aufgenommen worden, ob die Neuregelungen auf derzeit laufende Verfahren anzuwenden ist (§ 180 XX EnWG). Hier hat die Kommune die Entscheidung in der Hand: sie kann entweder das Verfahren nach dem bisherigen Recht abschließen oder durch eine Rügeaufforderung an die beteiligten Bieter der neuen Rechtslage zur Anwendung verhelfen.
Manches nicht geklärt
Mindestens ebenso wichtig wie die dargestellten Neuregelungen ist allerdings auch, was in der Gesetzesnovelle nicht geregelt worden ist – und das, obwohl es in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen und politischer Diskussionen gewesen ist. Die Gesetzesnovelle enthält nämlich keine Klarstellung zu der Frage, welche Kriterien eine Gemeinde mit welchem Gewicht zugrunde legen darf.
„Ob dies die richtige Entscheidung ist, wird sich zeigen“, sagt Helmes. „Zwar lassen fehlende gesetzliche Vorgaben den Gemeinden natürlich mehr Spielraum. Weil die Rechtsprechung, allen voran der Bundesgerichtshof, aber durchaus inhaltliche Anforderungen entwickelt hat, könnte sich die gesetzgeberische Zurückhaltung im Konfliktfall aber schnell als trügerische Freiheit erweisen.“ Offen bleibt vor allem, ob und wie eine Gemeinde ihren Willen zur Rekommunalisierung neben energiewirtschaftlichen Aspekten bei der Auswahlentscheidung berücksichtigen darf. Laut Gesetzesbegründung soll dies zwar der Fall sein – im allein ausschlaggebenden Gesetzestext hingegen herrscht beredtes Schweigen. Eines, immerhin, ist klar: die von kommunaler Seite gewünschte Möglichkeit zur schlichten „Inhouse“-Vergabe an ein gemeindliches Unternehmen bleibt weiterhin unzulässig.
Vom politischen Wunsch zur Rekommunalisierung bis zu seiner Realisierung bleibt es also auch künftig ein weiter Weg. „Ob die Neuregelungen wirklich die erhoffte Rechtssicherheit für alle Beteiligten zur Folge haben werden, bleibt angesichts dessen abzuwarten“, so Helmes abschließend.